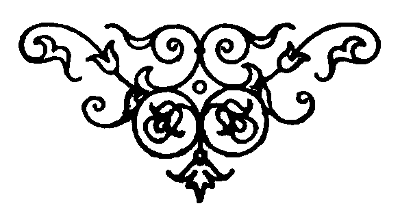VIII. Theil.
Allgemeines.
 luenau liegt bei 32‧12° öſtl. Länge faſt genau unter dem 51. Breitengrade, in einer Höhe von 342 Meter (Kirenpla) 350 Meter (Marktpla) über dem adriatiſen Meere und wird von dem Silberba durfloſſen, weler unweit der Stadt ſi mit dem aus dem Boxtei abfließenden Kaſelba (z. g. Lilienteiwaſſer, Waldwaſſer) vereinigt, gemeinſam dann der Spree zuſrebt, in wele ſi dieſe Wäſſer bei Taubenheim (Neue Sorge) in Saſen ergießen.
luenau liegt bei 32‧12° öſtl. Länge faſt genau unter dem 51. Breitengrade, in einer Höhe von 342 Meter (Kirenpla) 350 Meter (Marktpla) über dem adriatiſen Meere und wird von dem Silberba durfloſſen, weler unweit der Stadt ſi mit dem aus dem Boxtei abfließenden Kaſelba (z. g. Lilienteiwaſſer, Waldwaſſer) vereinigt, gemeinſam dann der Spree zuſrebt, in wele ſi dieſe Wäſſer bei Taubenheim (Neue Sorge) in Saſen ergießen.
Die Umgebung Sluenaus bietet eine lieblie Abweslung von Berg und Thal, von Wald und Feld. Der Ort iſt umkränzt im Norden vom Spienberg (474 M.) vom Judenberg, dem Fugauer Gelände, im Westen vom Boenberg (541 Meter), im im Süden vom Pirsken (605 M.), Loders- (423 M.), Kreuz-(398 M.) und Silberberge (393 M.), im Oſten vom Butter- (386 M.), ſowie dem Jüttelsberge (Göttelsberg) (507 M.) Faſt die meiſten Berge um Sluenau ſind vorherrſend Granitergebungen und gehören zu der großen Granitzone, wele von Stoplen aus über Biſofswerda, Bauen, Löbau, Herrnhut hin die ſäſ. Oberlauſi bis an die Quaderſandſteingruppe im Süden einſließt. Der Höhenzug von Waldee bis Kunnersdorf, jener an der böhmiſ-ſäſiſen Grenze von Sohland, Taubenheim, ferner der bei Königswalde werden vom Granit aufgebaut. Au in den Thälern wird er ſelten von anderen Erdſiten ho bedet unr tritt faſt überall zu Tage.
Im Allgemeinen iſt es der normale Lauſi-Granit, do finden ſi au bei Sluenau und Umgebung Granitabänderungen theils in Gangform, theils als Kuppen oder eingeſloſſene Parthien vor, wele ganz veränderlies Gefüge zeigen, dem normalen Granit kaum no ähnli ſind, jedo demſelben angehören. So finden ſi weſtli von Waldee am Bahneinſnitte ſön ausgebildete Sriftgranite, ſonſt au ſehr feldſpathreie bläulie Gänge. Weiter weſtli folgen feinkörnige granulitartige Durgänge. Näher an Sluenau kam dur den Bahnbau ein dunkellaugrünes Geſtein zu Tage, weles dur reilie Beimengung von Sericit (Glimmer) faſt gneißartig erſeint. Am unteren Ende von Königswalde, ohnweit der Rumburg-Sluenauer Straſſe lagert eine grünli-graue Maſſe von felſitiſem Character, wele ſi auf den Fluftfläen fettig anfühlt und Chlorit oder Talgpartikel enthält. Feinkörnige, glimmerarme Varietäten finden ſi zwiſen Hainspa und Sönau; am Knoenberge wurde ein ſoler Gang im Granit beobatet, weler no dazu von einem Grünſteingange begleitet iſt. Au der ſogenannte Rumburger Granit, der ſi dur grobkörnige Zuſammenſeung vom Lauſier Granit unterſeidet, erſtret ſi bis nahe an Waldee.
Zwiſen der Königswalder Kire und der Rumburger Straſſe beginnt eine mätige Quarziteinlagerung, wele in einem breiten Streifen oſtwärts über den Ziegenrüen bis zum weißen Staar bei Spikunnersdorf mit einigen Unterbreungen verläuft.
Sehr häufig findet man die Granite au von Dioritgängen durſet. Die ſmalen Adern zeigen ſi meiſt ſehr feinkörnig, dunkel, viele ſind zu thonigen Broen verwittert, die größeren Einlagerungen dagegen erſeinen faſt immer großkörnig, von dunkel grünli-grauer Färbung und faſt immer finden ſi meſſinggelbglänzende Pünkten von Swefeleiſen (Swefelkies) darin enthalten.
Nördli von der Königswalder Kire auf dem granitiſen Kreuzberg iſt ein deutlier von Süd na Nord ſtreiender Grünſtein- und Rotheiſenſteingang. Im Sluenauer Walde, im Sweidri liegen große Dioritblöe in Menge herum und deuten daruter liegende Gänge an. So au bei Roſenhain und an dem Wege na Neuſalza beim Grenzübergange. Weſtli von Wladee iſt dur den Bahnbau eine Parthie ſiefrigen Aphanites blosgelegt worden. Weiter iſt au hinter Sluenau an der Straſſe na Hainspa der Granit von zahlreien Grünſteingängen durzogen und südli davon bei Kaiſerswalde liegen viele Stüe Grünſteinſiefer in einem breiten Streifen beim Berghange umher. In großen Maſſen iſt der Diorit am Taubenberge und öſtli davon am Safberge in Granit eingelagert.
Neuere Eruptionsgeſteine und zwar die Baſalte von grau-ſwarzer Farbe haben au in dieſer Gegend die Granitdee durdrungen. In ſönen Säulenformen tritt der Baſalt am Boenberge auf; ferner findet ſi bei Neuherrnwalde ein Baſaltgebiet von mätiger Ausdehnung vor. Kleinere Durbrüe lagern zwiſen Königswalde und Kunnersdorf, bei der Annakapelle in Sönau, auf einer Höhe zwiſen Oberneudorf und Sluenau, ſüdöſtli von Oberkönigswalde, auf der Ritung des ſon erwähnten Quarzitganges ein kleiner Hügel mit viel Olivin nebſt Augiteinſlüſſen. Auf dem Calvarienberge bei Sluenau befindet ſi außer ſäulenförmigem Baſalt au ein Gang im Granit, weler Eiſenglanz, Quarz und Chlorit enthält. Die Thäler ſelbſt ſind zumeiſt mit diluvialem Lehm ausgefüllt.
Bei Zeidler fallen die Siten des Jurakalkes etwa 45° na Nordweſt hin unter dem Granit ein und ſind vermengt mit ſandigen oder rothgefärbten thonartigen Lagen. In dieſen Kalkſiten kommen eine große Anzahl von Verſteinerungen vor und laſſen ſi als Ueberreſte der Bewohner des Jurameeres verſiedenartige Ammoniten, Terebrateln, Muſeln, diverſe Thiere nebſt Spongien erkennen.
Zu verſiedenen Zeiten wurde au na Kohle gegraben, ſo zu Sluenau, Ehrenberg, Hainspa, Sönau, jedo ohne lohende Reſultate. Ganz neuerdings, im Jahre 1888, ließen die Herren Johann Pfeifer und Eduard Mori Neuberth zu Kleinſönau 64 Meter tiefe Kohlenbohrungsverſue im Breiten Buſ
bei Hainspa vornehmen mit naſtehendem Ergebnis :
Na einer Humusſit mit Baſaltſtüen von 1 Meter Mätigkeit kam 2 Meter Lehm, dann 30 Meter thoniger Letten; in den härteren Stüen dieſer Letten finden ſi goldglänzende Pyritwürfel vor, wele das Vorhandenſein von Brauneiſen in der Nähe der Bohrſtelle erklärli maen. Weiter wurde ein 25 Meter ſtarke Spelettenſit aus Grünſtein durſtoßen, ſodann fand man 2 ½ Meter Aanit und endli Granit. Ein anderer 19 Meter tiefer Bohrungsverſu unweit des Rothen Teies
ergab: vorerſt loere, eiſenhaltige Erde mit Braun- und Holzkohlenſtüen, dann feſte rothe Erde, vermiſt mit ſlaenartig ausſehender Kohlenmaſſe, weiter eine kleine gelbe Lehmſit, ferner grüner Ton, grüner Sand mit Waſſer und ſließli Granit.
Wegen der gebirgigen Umgebung und der hohen Lage kann man das Klima in und bei Sluenau nur als ein ziemli rauhes claſſificiren, die Jahrestemperatur ſteht durſnittli tief, weshalb mane Culturgewäſe, wie Wein, Wallnüſſe und zarte Obſtſorten nit ret gedeihen wollen.
Von Baumfrüten werden gepflegt und gepflanzt in den verſiedenſten Sorten: Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirſen, Haſelnüſſe. An Zierpflanzen cultivirt man: Astern, Aurikel, Buxbaum, Crocus, Coniferen, Epheu, Eſſigbaum, Erbſenſtrau, Eiſen- und Fingerhut, Flieder, Fuſien, Geiſsblatt, Georginen, Geranie, Gloenblume, Goldla, Goldregen, Gladiolen, Gänſerösen, Hahnenkamm, Hyazinthe, Jasmin, Kactus, Kaiſerkrone, Kapuzinerkreſſe, Kreuzkraut, Lavendel, Lebensbaum, Lovkoy, Lilie, Löwenmaul, Magnolien, Mandelaprikose, Maulbeerſtrau, Myrthe, Narziſſe, Nelken, Orleander, Pelargonien, Pfaffenhüten, Pfeifenſtrau, Pfingſtroſe, Primel, Roſen, Rosmarin, Reſeda, Ritterſporn, Sadebaum, Salbei, Sonnenblume, Siefblatt, Sneeglöen, Sneeball, Sternblume, Stiefmütteren, Swertlilie, Traubenkirſe, Tulpe, Tulpenbaum, Veilen, Waſſerſtrau, Waolder, Wildwein, Zinnie.
Vorfindli ſind naſtehende Arzneipflanzen: Aloe, Arnica, Baldrian, Bärlapp, Bitterſüß, Beifuß, Bitterklee, Brunelle, Doſte, Ehrenpreis, Eibiſ, Erdrau, Farnkraut, Flieder, Faulbaum, Gundermann, Gilftlatti, Hollunder, Kamille, Kalmus, Klette, Königskerze, Krauſemünze, Kümmel, Kreen, Labkraut, Lungenkraut, Majoran, Malve, Meliſſe, Mohn, Mutterkorn, Nelkenwurz, Pfefferminze, Queke, Raute, Rhabarber, Safgarbe, Sanikel, Skabioſe, Seidelbaſt, Stiefmütteren, Thymian, Tollkirſe, Tauſendguldenkraut, Waldmeiſter, Wegeri.
Und von den Gilfpflanzen gibt es: Gefleter Aron, Bilſenkraut, Bitterſüß, Einbeere, Eiſenhut, Fingerhut, Fliegenpilz, Goldregen, Gauheil, Hahnenfuß, Herbſtzeitloſe, Kirſlorbeer, Mauerpfeffer, Mohn, Natſatten, Nießwurz, Satelhalm, Söllkraut, Swertlilie, Seidelbaſt, Steapfel, Sierling, Scilla (Meerzwiebel), Taumellol, Tollkirſe, Wolfsmili, Waldrebe.
Der Gemüſebau fördert: Bohnen, Dill, Erbſen, Gurken, Kreen, Kürbiſſe, Knoblau, Paradiesäpfel, Peterſilie, Poree, Radiesen, Rettige, Salat, Spargel, Sellerie, Spinat, Snittlau.
Als Futtergräſer finden ſi auf den Wieſen: Fusſwanz, Hainſimſe, Honiggras, Kammgras, Knäuelgras, gemeiner Lol oder engl. Reygras, Glatthafer, Lieſgras, Perlgras, Rugras, Zittergras, verſiedene Gattungen Trepſe und Rispengras, und ebenſo an wildwaſenden Kräutern:
Ampfer, Augentroſt, Bärenklau, Brennneſſel, Brunelle, Feldthymian, Gloenblume, Günſel, Hahnenfuß, Hopfenſneenklee, Hornklee, Hornkraut, Klettenkerbel, Vogel- und Natterknöteri, Kreuzblume, Kreuzkraut, Kümmel, Labkräuter, Löwenzahn, Safgarbe, Taubneſſel, Watelweizen, Wegeri, Wieſenbosbart, Wieſenplatterſe, Wieſenſaumkraut, Zaunwie.
Im Landbau kommen in Ausſaat: Korn, Hafer, Gerſte, Weizen, Wien, Erbſen, Linſen, Bohnen, rother wie weißer Klee, Kneel, gelbe Lupine, Pferdezahn (Mais), Flas und ferner werden als Hafrüte gepflanzt: Kartoffel, Runkelrübe, Stoppelrübe, Kraut (rothes), Kohlrübe, weiße Waſſerrübe, gelbe Rübe.
Faſt das ganze Gebirge um Sluenau iſt mit Wald bedet und die hier vorherrſenden beſtandsbildenden Holzarten ſind: die Fite, die Kiefer, die Birke. Als untergeordnete, in den Beſtänden eingeſprengte Hölzer kommen vor: die Tanne, die Eie, die Weißbue, die Läre und der Bergahorn. Erle nebſt Weide treten au in den näſſer liegenden Thalſtreen auf und finden ſi zumeiſt im bunten Gemiſ mit Vogelhollunder, Kreuzdorn wie Weißdorn. Ebereſe und Waolder ſind ſeltener vertreten.
Nur von geringer Bedeutung iſt der Wildbeſtand in obigen Waldrevieren. An jagdbaren Thieren gibt es: Haſen, Rehe, Rebhühner, Birkhühner, Waſſerhühner, vereinzelter Haſelhühner, Wateln, Wildtauben, Bekaſſinen, Waldſnepfen, Krammetsvögel, Füſe, Marder, Iltiſſe, Wieſel, Hamſter, ſelten Daſe, Igel, Eihörnen, Buſſarde, Habite, Sperber, Eulen,Raben, Krähen und Elſter. Zahlreier dagegen iſt die Vogelwelt vertreten und niſten um Sluenau: Mauerſwalbe, weiße wie gelbe Baſtelze, Feldlere, Singdroſſel, Amſel, Ziemer, Waſſerstaar, Staar, Pirol, Fliegenſnäpper, Steinſmeer, Rothkehlen, Blaukehlen, Gartenrothſwanz, Gartengrasmüe, Dorngrasmüe, Swarzplatte, gelber Gartenſänger, Zaunkönig, Goldhähnen, Haubenmeiſe, Kohlmeiſe, Swanzmeiſe, Haubenlere, Haidelere, Goldammer, Gimpel, Hänfling, Edelfink, Stiegli, Hausſperling, Baumläufer, Blauſpet, Uferſwalbe, Grünſpet, Buntſpet, Swarzſpet, Wendehals, Kukuk, Eisvogel, Ringeltaube, Watelkönig, kleiner Steißfuß.
Unter den Viehgattungen werden gezogen: das Pferd, verſiedene Rinderracen, Ziegen, Sweine, Lämmer; au Kaninen ſind als Hausthiere nebſt den verſiedenen Hundegattungen wie Kaenarten gehalten.
Von Federvieh gieb es Gänſe, Enten, Hühner und Tauben. Bienenzut wird ſeltener getrieben und hat wenig Freunde.
Das Heer der hiergegends beobateten Inſecten iſt groß, ſo der Käfer, Wespen, Smetterlinge, Fliegen und Neflügler, Sreen und Wanzen. Dagegen ſind Gehäuſeſneen und Muſeln nur ſpärli vorhanden.
Als Waſſerbewohner mögen genannt ſein: Forelle, Karpfen, Karauſe, Sleie, Het, Smerle, Steinbeißer, Ellrüe, Flußkrebs, ſowie der Waſſerſwamm (Spongilla Fluviatilis). Und von den wildlebenden Reptilien ſeien angeführt: Glatte Natter, Ringelnatter, Blindſleie, gemeine Eſe, garuer Grasfroſ, gemeine Kröte und einige Arten Waſſermole.