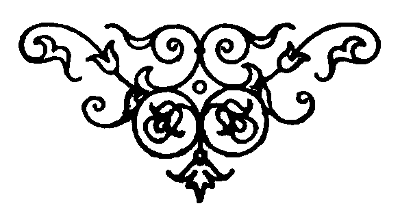I. Theil.
400 v. Ch. – 1412 n. Ch.
Aelteſte Nariten. – Bojer und Markomannen. – Slaven, Tſe. – Lutitier (Lutizier) und Somnones, Sorben und Eliſii. – Slaviſe Niederlaſſungen. – Ausbreitung des Chriſtenthums. – Deutſe Burgenbauten und Ortsanlagen. – Premysl Ottokar I. und II.. – Marquarde. – Gründung und Name von Sluenau. – Wartenberge. – Leinwandweberei und Handelsſaen. – Berka's von der Dauba. – Kirenangelegenheiten. – Hinco Berka von der Dauba I., II. und III. – Johann auf Tollenſtein. – Heinri auf Wildenſtein. – Hinco, der Aeltere. – Stadtbefeſtigung. – Stadtwappen.
 öhmen wurde in älteſter Zeit, etwa 400 Jahre vor unſerer Zeitrenung, von den Bojern, dem berühmten Zweige des einſt mätigen keltiſen oder galliſen Völkerſtammes beſiedelt, wele daſelbſt, ohne feſte Wohnſie zu nehmen, von Jagd nebſt Fiſerei lebten. Dieſen Urbewohnern folgten Deutſe, die kriegeriſen, tapferen Markomannen, wele aus der Mainlandſaft her na ſiegreien Kämpfen unter ihrem Herzog Marboth, 80–70 v. Ch. in Bojenheim vordrangen, das Land in Beſi nahmen und ſelbes faſt in allen Theilen urbar maten.
öhmen wurde in älteſter Zeit, etwa 400 Jahre vor unſerer Zeitrenung, von den Bojern, dem berühmten Zweige des einſt mätigen keltiſen oder galliſen Völkerſtammes beſiedelt, wele daſelbſt, ohne feſte Wohnſie zu nehmen, von Jagd nebſt Fiſerei lebten. Dieſen Urbewohnern folgten Deutſe, die kriegeriſen, tapferen Markomannen, wele aus der Mainlandſaft her na ſiegreien Kämpfen unter ihrem Herzog Marboth, 80–70 v. Ch. in Bojenheim vordrangen, das Land in Beſi nahmen und ſelbes faſt in allen Theilen urbar maten.
Bojer und Markomannen haben deutlie Spuren au in unſerer Gegend zurügelaſſen. Die Ringwälle (verſlate Wälle) auf dem Löbauer Berg, dem Rothſtein, die Wagſteine oder Waelſteine des Töpfers, jene von Niederſönau und Sternberg bei Zeidler, die Namen Neiße, Elſter, Pirna ꝛc. ſind den Kelten zuzuſreiben, während der Oybin, der Ameiſenberg bei Oybin, die Lauſe, der Kottmar, auf germaniſen Göttercult, Wodan-, Thor- und Friggaanbetung hinweiſen. Au die uralten Sagen, Aberglauben und volksthümlien Gebräue der Weihnats- und der Oſterzeit, z. B. das Oſterreiten, der Kampf des Lenzes mit dem Winter, das Todaustreiben, das in den April ſien, ferner zu Walpurgis, Pfingſten, am Johannisabend, die Tage zu St. Miael und St. Martin beſtimmen uralten deutſen Kultus.
Der weitere Verlauf der Völkerwanderung von Oſt na Weſt brate 494 n. Ch. einen Stamm der Slaven unter ihrem Anführer Tſe na Böhmen. Von Oſten aus beſeten ſie die frutbaren Ebenen und maten ſi in einzelnen Gehöften oder geeinten Dörfern ſeßhaft. Au über die Landesgrenze hinaus giengen ſie; nur die Randgebirge blieben von ihnen unbeſet, wohin die Deutſen zumeiſt gedrängt wurden. Die Anſiedlungsart der Germanen iſt weſentli verſieden von jenen der Slaven. Son der römiſe Hiſtoriker Tacitus ſagt von den Deutſen: Sie ſiedeln ſi in zerſtreuten Gehöften an, in einem Walde, an einem Bae wie es eben Jedem gefällt,
während die Slaven dit gedrängt ihre Häuſer meiſt um einen reteigen Pla reihen.
Ein anderer Zweig der Slaven ließ ſi um 513 n. Ch. an der nordöſtliſten Seite des heutigen Böhmerlandes und in der Lauſi nieder, wo die Sueben, eine deutſe Bevölkerung, geweſen und zwar verdrängten die ſlaviſen Lutitier (Lutizier) in der Niederlauſi die germaniſen Semnones, die Sorben in der Oberlauſi die Eliſii. Gennaten Slaven pflegten ebenfalls ihren Göttercultus und wennglei derſelbe weniger ausgebreitet wie der germaniſe war, ſo hatten ſie immerhin mehrere Opferſtätten in unſerer Gegend erritet. Dem vornehmſten Sorbenwendengott Flynß, dem Gott des Todes wurde bei Bauen und Görli geopfert, ferner gab es Verehrungsſtätten der Siva, Göttin des Lebens, dem Belbug, Gott des Guten, dem Zernebog, Gott des Böſen und der Göttin Mara, für letere angebli auf dem Kottmar.
Tſeen ſowohl wie Sorben, au Soraben, von den Deutſen aber Wenden oder Sorbenwenden genannt, zerfielen in einzelne kleinere Stämme, wele in beſtimmten Diſtricten oder Zupen, Zupanien benannt, wohnten und eigene Vorſteher (Zupane) hatten. Um Saaz lebten die Lutſaner, um Leitmeri die Lutomirizer, um Tetſen die Datſauer, gegen Oſten zu die Luizizier, gegen Süden die erſteren benabarten Luſizer, wele ſi wieder in Milzener (Gau Milza, Bauen) Dalemincia, (Meißen) Niſania (Dresden) in der Oberlauſi und Luſizer (Gau Luſici, Selpuli und Zara) in der Niederlauſi unterſieden; an dieſe angrenzend die Bewohner des Gaues Zagoſt.
Umgeben von deutſen Landen beſäftigten die Slaven ſi mit Aerbau nebſt Viehzut und verhandelten ihre Produkte hauptſäli an ihre deutſen Nabarn.
Dur den ſteten Verkehr zwiſen Deutſen und Slaven konnte der Einfluſs, die Einwirkung der Erſteren auf Letere nit ausbleiben. Vor allem war es das Chriſtenthum, weles zahlreie Deutſe zu den Slaven führte. Als Glaubensboten kamen vorerſt Möne wie Eremitem, die nit allein Chriſti Lehre verbreiteten, ſondern au Aer-, Garten- und Obſtbau trieben. Do dieſe friedlie Berührung beider Nationen ſollte nit von langer Dauer ſein und es entſtanden, dur Grenzſtreitigkeiten hervorgerufen, arge Feindſeligkeiten. Unter Karl dem Großen begannen die Kämpfe. 805 wurde der erſte bedeutende Feldzug gegen die Daleminzier, wele die Polen zu Hilfe riefen, unternommen. Siegrei drangen die deutſen Waffen vor und damit war der erſte Sritt zur Unterdrüung der ſlaviſen Unabhängigkeit gethan. Um dieſe Erfolge zu ſiern, ſoll Kaiſer Karl der Große dem Würzburger Biſof Bernwelf befohlen haben, in den eroberten Ortſaften Kiren zu erriten und bereits 894 war das Chriſtenthum bis zu den Grenzen der Lutizier verbreitet. In den Kämpfen mit den Daleminziern, Sorben und Tſeen von 926 an hatten während des 10. Jahrhundertes die Deutſen große Erfolge erzielt; der Widerſtand der Milcener dauerte am längſten, do wurden au dieſe zu Ende des 10. Jahrhundertes den Deutſen botmäßig.
Mit der Eroberung der Landenſritt die Chriſtianiſirung immer weiter vor. Biſof Thietmar, (Thieddeg, Ditmar) ein Benedictinermön aus Magdeburg ward als erſter Prager Biſof am 7.Mai 973 inthroniſirt. Es erhoben ſi die Bisthümer Magdeburg 962, Merſeburg 968, Zei 968 und Meißen 968, wele für die Verbreitung des Chriſtenthums weſentli vorſorgten. Das von Kaiſer Otto I. geſtiftete Bisthum Meißen verwaltete als erſter Biſof Burard (Burghard, Burcard), ein Benedictinermön aus dem St. Johanniskloſter zu Magdeburg und gehörte urſprüngli nur der Gau Daleminzi dazu. Gegen Ende des 10. Jahrhunderts iſt der Gau Milzeni, wozu ein Theil des heutigen böhmiſen Niederlandes bis zum Quell der Spree gezählt wurde, dann im eilften der Gau Luſici dabei, wel' leterer bis dahin einen Beſtandtheil des Bisthums Brandenburg bildete, ferner der Gau Niſani.
Die Lauſier wehrten ſi gewaltig, Chriſten zu werden und rebbelirten dieſerwegen 1035 zur Zeit Conrads II., 1056 unter Heinri III., als au zur Zeit Kaiſer Heinri IV. anno 1066.
Ein weiteres witiges Bindeglied zwiſen den Deutſen und den Slaven bot der Handel. Salz wurde von Baiern na Böhmen geführt, Erzeugniſſe des Gewerbefleißes kamen vom Rhein, Flandern, Brabant und von Norden her, als Seiden-, Leinen-, Tuwaaren nebſt Goldſmiedearbeiten. Au deutſe Bergleute fanden ſi ein, um den Reithum des Landes an Erzen zu erſließen. Viel zu gut ſahen die tſeiſen Großen und Könige ein, weler hohe Culturwerth dem detſen Elemente innewohnt. Ganz beſonders war es das Königsgeſlet der Przemisliden, die aus materiellen Gründen, als zur Steigerung der Kroneinnahmen, zur Sierung der Grenzen und zur Hebung der Kultur die Deutſen bewogen, ſi vermehrt im Lande niederzulaſſen. Letere ſtellten jedo zuvor ihre Bedingniſſe, wele ihnen gewährt wurden.
Die Deutſen trennten ſi von der Zupengewalt los, anerkannten nit das ſlaviſe Ret, ſeten eigene Behörden ein und regelten ihre Juſtizverhältniſſe zumeiſt na Magdeburger Ret. Son König Wratislaw II. (1061–1092) erbaute, nadem er von Kaiſer Heinri IV. für ſeine Treue im Kriege wider Papſt Georg VII. die Oberlauſi mit der Markgrafſaft Meißen 1076 als Lehen erhielt, zur Sierung vor feindlien Einfällen Burgen an der Grenze; ſo entſtand au die Burg Kamni, ſowie in der Nähe von Meißen die Burg Gouzdek. Wratislaw überließ die beiden pagos Niſen und Budeßin oder Milze bei der Verheiratung ſeiner Toter Judith mit Graf Wipret von Groitſ anno 1086 ſeinem Eidam als Lehen. Derſelbe beſaß ſoles von 1086 bis zu ſeinem Tode 1124 und beſiedelte es mit Deutſen aus Thüringen wie Franken.
Seit Przemysl Ottkar I. (1197–1230) hatte ſi in Böhmen das deutſe Element großen Einfluß geſiert und es entſtehen neben der bereits dur Wratislaw II. privilegirten Stadt Prag deutſe Städte und Dorfgemeinden. Am günſtigſten war Ottokar II. den Deutſen geſinnt, weler als der vorzügliſte Städtegründer anzuſehen iſt. Unter ihm gab es 24 Städte, die ganz oder überwiegend von Deutſen bewohnt waren. In den Deutſen fand er eine ſiere Stüe gegen den übermüthigen, herrſſütigen Adel, er rief in Menge erſtere in ſein Rei, ertheilte ihnen Privilegien und bedate ſie mit Grundſtüen zum Baue von Wohnſien. So kam Handel und Gewerbe, Kunſt und Wiſſenſaft in's Aufblühen im Böhmerlande. Unſere engere Heimath ſelbſt blieb von dieſem neuerwaten Leben nit unberührt. Böhmiſe Adelsgeſleter ſtrebten Ottokar I. wie Ottokar II. na, förderten auf ihren anſehlien Grundbeſiungen ebenfalls Anſiedlungen von deutſen Bauern und Handwerkern.
Im heutigen Nord- und nordöſtlien Böhmen waren die Marquarde die mätigſten Herrengeſleter und hatten deren einzelne Linien, als von Lämberg, (Löwenberg) Zwirzeti, (Zwerzeti) Mialowi, (Mielsberg) Wartenberg, Ralsko, Waldſtein einen ausgedehnten Landbeſi. Der Ahnherr dieſer Marquarde lebte unter König Wladislaw I. (²/₁₀ 1109–¹²/₄ 1125) und führte im Wappen einen aufreten Löwen. Ein Enkel desſelben, Namens Beneſ ſlug im Jahre 1203 die Saſen bei Großſkal in Böhmen und gehörte jenem Hauſe an, weles ſpäter die Namen von Löwenberg (Lämberg), von Wartenberg und von Waldſtein annahm. Ein Bruder oder Sohn dieſes Beneſ war Marquard von Jablona, deſſen Söhne Jaroslaw und Gallus 1241 die Burg Löwenberg bei Gabel erbauten, während die beiden anderen Söhne Marquard und Hawel ſi von Ralsko nannten. Ein Sohn des letgenannten Marquard, der mit Dorothea Berka von Dauba vermählt war, erritete 1256 die Stadt Wartenberg und um dieſelbe Zeit wurde von den Wartenbergern die Burg Tollenſtein erbaut.
Es muß angenommen werden, daſs, wenn nit ſon früher, ſo in dieſer Periode au Sluenau, weles zum Gaue Milsca gehörte, gegründet wurde. Wohl immerdar wird die Entſtehungsgeſite Sluenau's in tiefes Dunkel gehüllt bleiben und niemals das genaue Jahr genannte werden können, in welem der Grund zu dieſer jet an 4623 Seelen zählenden induſtriereien und gewerbfleißigen Landſtadt gelegt ward.
Im Grenzregulirungsvertrage von 1213 zwiſen Böhmen und Biſof Bruno II. zu Meißen (1209–1228) iſt dieſer Ort no nit genannt. Dagegen kommt der Name dieſer Stadt zuerſt in einer Urkunde von 1281 in Erwähnung, worin geſagt iſt, daſs am 9. Januar Biſof Withego I. (1266–1293) von Meißen den Kauf von 4 Hufen in dem biſöflien Dorf Biſdorf bei Löbau, wele das Domcapitel zu Bauen von dem Bürger Rudegher von Slaukenowe für 46½ Mark erworben, beſtätigt. Ebenſo bezeugt 1296 den 6. März in einer anderen Urkunde der Rath zu Bauen, daſs Frau Katharina, Wittwe des Bürgers Rudegher (Rüdiger) von Slaukenowe und ihr Sohn Johann dem Domcapitel 10 Silling Zins auf 3 Gärten in der Hundsgaſſe verkauft haben.
Dieſes Slaukenowe, ſpäter, wie zu erſehen ſein wird, Slaknaw (1359) Slaknovia (1388) genannt, iſt Sluenau.
No nit völlig aufgeklärt iſt die ſpralie Ableitung dieſes Stadtnamens. Von den Urtheilen der Autoritäten in der deutſen wie ſlaviſen Literatur bleibt am unanfetbarsten jenes des Herrn Gymnaſialprofeſſors A. Paudler in B.-Leipa, weler ſagt: Der Name der Stadt Sluenau iſt zweifellos deutſen Charakters und Urſprungs.
Daher iſt es kaum nöthig zu bemerken, daſs, ſo viel mir bis jet bekannt geworden iſt, keine der ſlaviſen Benennungen, von denen man Sluenau abzuleiten verſut hat, lautgeſeli jemals den Namen Sluenau ergeben kann. Der zweite Beſtandtheil des Namens iſt au in Nordböhmen überaus übli; awe iſt eine veraltete Form,aw nur eine veraltete Sreibung für unſer au. Der erſte Beſtandtheil dagegen hat bisher no nit genügend erklärt werden können. Demna iſt es ſehr wahrſeinli, daſs Sluen
mit Slaen
in Slaen-Werth
und Slaggen-Wald
identiſ iſt. Die Forrm Slauken in Slaukenowe
, weles bereits 1281 naweisbar iſt, dürfte zwiſen Sluen
und Slaen
den Uebergang gebildet haben. Durch dieſe Hypotheſe dürfte au die Wortform Slaknaw
, wele 1359 vorkommt, ihre angemeſſene Erklärung finden. Sließli betrate i es als eine freili anfetbare, aber do erwähnenswerthe Vermuthung, daſs das Wort Slaen, Sluen oder Slauken
urſprüngli eine ſlaenähnlie Boden- oder Steinart bezeinet haben mag.
Der Ortsname Sluenau iſt ohne Zweifel wendiſen reſp. ſlaviſen Urſprungs, wie aus den urkundlien Bezeinungen klar zu erſehen iſt. Das Städten heißt heutzutage no bei den Wenden um Bauen Slanknow. Es hat mit dem wendiſen Dorfnamen Slónkecy, deutſ Slungwi, bei Bauen gleie Abſtammung von slanek (altſlaviſ slanuku, wendiſ slon(e)k = Salzſieder. Slanknow iſt eigentli Adjektivum, wozu als Subſtantiv sedlišté = Anſiedlung der Salzſieder, zu ergänzen iſt. –Profeſſor Pfuhl in Neſwi meint:
Wendiſ heißt die Stadt Slanknow. Dieſe Form ſeint auf das märiſe Lainkowi
zu weiſen, weler Name in ſlaviſer Umbildung Slavikovice
klingt. Die alte urkundlie Form Slaukenowe
deutet wohl auf slawik
wendiſ solobik = Natigall,
ſo daſs alſo Sluenau ſoviel als Natigallenort heißen würde. –Andere äußern:
Die Möglikeit beſteht, daſs ſluen und ſlaen mit dem Worte
ſlingen zuſammenhängt, alſo ſi ſlängende Au heißen mag. –Nit unwahrſeinli könnte ſein, daſs Slaukenowe vom Perſonennamen Slauko, Slawek = Slawkenau ſtammt. –
Die volksthümlie Anſit, na weler Sluenau von
Slottenau oder Sluttenau kommen ſoll, iſt haltlos.
Mithin läſst ſi behaupten, daſs Sluenau eine deutſe Gründung, deutſen Urſprungs iſt.
Um 1255 kamen in die Lauſier Städte flämmiſe Auswanderer und braten aus den altſäſiſen Städten die Kenntnis der Tumaerei mit, wele das Hauptgewerbe der Städte wurde. In den älteſten Görlier Rathsbüern werden die Tumaer Flemmige betitelt, die Zuſammenkünfte derſelben Morgenſprae geheißen und ihre Tuqualitäten Söngewand, Landgewand, wie Floentüer genannt.
Zittau, Bauen, insbeſondere Görli lieferten gute, ſogenannte niederländiſe Tue, wele na Dänemark, Sweden, Norwegen, Preußen, Litthauen, Ungarn, Swaben, Würtenberg, Polen, Rußland und den böhmiſen Städten abgeſet wurden. Zittauer Tuhändler hatten bedeutenden Abſa na Prag. Zur Förderung dieſes Handels gewährte Ottokar 1255 Zollfreiheit der Tue na Böhmen. Mit Thüringen ſtanden die Lauſier Städte wegen Bezug von Waid in ſtarkem Verkehr. Der Waid (Iſatis, Glaſtum), weler im Mittelalter, no ehe der Indigo gekannt war, die blaue ſowie andere dunkle Farben gab, deſſen Blätter man mahlen oder ſtampfen und dann in Kugelform bringen mußte, wurde in Thüringen, hauptſäli in Erfurt gebaut.
Görli hatte unter den Markgrafen von Brandenburg ſon das Ret, daſs aller Waid dort abgeladen werden mußte, weler in die Lauſi verfratet wurde. Dieſes Monopol rief den Neid der anderen Städte wa und dieſelben ſuten lange Zeit vergebens um gleie Waidrete
, wie ſie Görli hatte an. Erſt am 28. Juli 1339 erhielt die Stadt Zittau vom König Johann von Böhmen die Erlaubnis, für ihren eigenen Gebrau Waid direkt beziehen zu dürfen.
Nit allein im Tauſwege, au gegen baare Münze fanden die Tue Abſa. Münzen und Geldwerthzeien wurden in Meißen erſt von Markgraf Ekkehard I. (1002 †) geſlagen und zwar Solidi oder Sillinge. Bis dahin behalf man ſi mit Reiswährung zu denen im 10. und 11. Jahrhundert die in Magdeburg geprägten Okelpfennige mit erhabenem, reifenartigem Rande und dem Bilde eines umkränzten Kreuzes gehörten; dann die Denare und Solidi, wele auf beiden Seiten meiſt ein Kreuz und eine Kire mit dem Namen des Kaiſers und Münzortes zeigten. Der Schilling hatte 12 Denare d. i. Hohlpfennige oder Bracteaten von dünnem Silberble und nur auf einer Seite mit Gepräge. 120 Denare oder 10 Sillinge maten 1 Mark, 240 Denare oder 20 Sillinge 1 Pfund. In ſpäterer Zeit giengen 30 Sillinge auf 1 Mark Silber. Die meißniſen Bracteaten beginnen erſt mit Markgraf Otto dem Reien (1157–1190).
Der Marquadenzweig, die Wartenberger, gehörten unter den vornehmſten böhmiſen Adel und war bedat, ſeine Beſiungen immer mehr auszubreiten. Als König Przemysl Ottokar von Böhmen 1254 die Oberlauſi ſeinem Swager Otto III. Markgraf von Brandenburg abtreten mußte, verſtanden es die Wartenberger, gegen Oſten hin ihrem Grundbeſi weitere Grenzen zu verſaffen.
Ober- und Niederlauſi p. 164,165)Bei dem Brandenburger Hauſe blieb die Oberlauſi 65 Jahre, bis ſole na dem Tode Waldemar I. 1319 zur Zeit König Johann wiederum mit der Krone Böhmens vereinigt wurde. Dieſer König Johann tauſte dto. Prag, am 2. September 1319 von Heinri von Lipa für andere Ortſaften bei Krummau in Mähren die Stadt Zittau mit dem dazu gehörigen Gebiete, den Slöſſern, Rohnau, Oybin und Sonbu, welen Wiedererwerb denen von Lipa vom röm. König Heinri VII. dto. Frankfurt, am 20. Juli 1310 beſtätigt war, ein. (K. k. geheimes Haus-, Hof- und Staatsariv.)
Um die Stadt Königgrä, wele als Mitgift ſeiner Gattin Agnes 1316 an Herzog Heinri I. zu Jauer und Fürſtenberg kam, wieder zurü zu erlangen, tauſte König Johann dieſelbe gegen den Oberlauſier Beſivom Herzog Heinri aus, nämli den Kreis von Görli, Zittau und Lauban. (Carpzow Analecta Fastorum Zittaviensium IV. p. 136.) Görli gab Herzog von Jauer 1329 wiederum gegen böhmiſen Beſi [Trautenau] an König Johann.
Alle dieſe Beſiungen kamen jedo, da er ohne Leibeserben ſtarb, 1347 wieder an Böhmen. Sein Nafolger im Fürſtenthum Jauer war ſeines Bruders Bernhard von Sweidni älteſter Sohn Heinri II. Selbiger hinterließ nur eine Toter, wele Karl IV. heirathete und ſo kamen die Fürſtenthümer Jauer und Sweidni au an Böhmen.
Kaiſer Karl hat die Stadt Zittau dem Herzog Rudolf von Saſen 1349 [1348 ?] verpfändet, 1358 wieder abgelöſt und 1360 zu den 5 Städten der Oberlauſi Budeßin, Görli, Camenz, Lauban und Löbau geſlagen, wele ſi zu einem Bunde einten.
Von dieſer Zeit an iſt Zittau bei der Krone Böhmens 271 Jahre verbleiben, bis 1635 Kaiſer Ferdinand II. dieſe Stadt ſammt den beiden Markgrafenthümern Ober- und Niederlauſi 1622 an den Herzog Georg von Saſen zu einem Pfandſilling einräumte und bei dem Prager Frieden erbli abtrat. (Carpzow Analecta Fastorum Zittaviensium I. p. 3.)
Das Gebiet von Tetſen erhielten Johann und Wanek von Wartenberg 1305 als Geſenk König Wenzels III. Gegen Norden hin beſaßen die Wartenberger bereits um die Mitte des 13. Jahrhunderts Ländereien bis unterhalb des Städtens Gottleuba (Saſen) gegen Oſten zu das Gebiet bis hinter Rumburg, Sluenau, Wartenberg, demna faſt das ganze böhmiſe Niederland, benannt als Wartenberger Landel.
Au Blankenſtein kam in ihren Beſi. Die Wartenberger hatten mane von dieſen Gütern nit unmittelbar im Beſi, ſondern hielten ſi, wie viele Ihresgleien, zahlreie Vaſallen-Ritter, wele einzelne kleinere Ländereien theils als erblie und verkäuflie, theils als heimfallende Lehen von ihnen beſaßen. So waren au die Ritter Beneſ von Ontti, geſeſſen zu Seregeswalde und Peshko Fanthiſhen, geſeſſen zu Sewni (Sebni) Vaſallen der Herren von Wartenberg auf Tetſen.
Am Anfange des 14. Jahrhundertes, 1310, ſind obige Brüder Johann und Wanek von Wartenberg, Söhne des Oberſtmundſenk Beneſ von Wartenberg, Beſier von Ländereien in unſerer Gegend. Johann, ein entſloſſener Mann und tapferer Kämpfer, zuweilen von Straz genannt, war no 1315 Statthalter von Mähren, au Mitgeſandter an den römiſen König Heinri wegen Berufung Johann von Luxemburg's als König von Böhmen und ein großer Gegner der Deutſen. Bei der Belagerung von Koſtelec am Adlerfluſſe, wo er für ſeinen Freund Heinri von Lipa gegen das deutſe Bürgerthum kämpfte, traf ihn am 5. Jänner 1316 eine Wurfmaſine, wodur ſein Tod herbeigeführt wurde. Weil er keine leiblien Erben hinterließ, fielen nun ſämmtlie Beſiungen an ſeinen Bruder Wanek oder Wanko. Derſelbe zog 1337 mit dem König Johann gegen die lithauiſen Heiden und erhielt darauf das Obermundſenkamt des Königreies Böhmen.
Unter ihm kam der Handel zur Entfaltung. Mit Tuen zogen die Zittauer, Bauner und Görlier Tuhändler na Prag, Wien, Ofen, Poſen, Thoren in Preußen. Ebenſo war der Leinwandhandel im Swunge und wurde gute gebleite Leinwand na Prag ſowie ganz Böhmen verführt, von wo wiederum ſeit uralten Zeiten her Getreide eingehandelt worden war und dieſes na Sleſien zum Verkaufe gelangte. Das Weben von Leinwand verſtanden au ſon die Sorbenwenden. Sole bildete in alter Zeit ihre vorzügliſte Kleidung und im 10. Jahrhundert mußte Leinwand als eine Abgabe entritet werden. Leinwandhandel betrieben die Städte in der Oberlauſi erſtli im 13. Jahrhundert und vorzügli über Böhmen na Nürnberg.
Ein einträglier Handelsgegenſtand war au Salz. Das Lüneburger oder Traven-Salz kam über Lübe und die Oſtſee in unſere Gegend und war manen Zöllen unterworfen, wele die Fürſten erhoben. Neben dem Salz bildete der Häring, deſſen Einſalzen nit erſt Wilhelm Böel im 15. Jahrhundert erfunden hat, eine vielgebraute Speiſe. Der Häring von der Oſtſee kam über die Oder na dem öſtlien Deutſland. In Oderberg war die erſte Häringsniederlage, dann gab es ſole in Frankfurt, Guben, Zittau, letere für unſere engere Heimat. Außerdem bezog man gemiſtes Wollgewebe, Pfeffer, Kümmel, Weihrau, Swefel, Weinſtein (de vini lapide), Mandeln, Blei ꝛc., womit der Handel na dem Inneren Böhmen's ziemli umfangrei betrieben wurde; au Zittauer Bier gieng na Böhmen.
Bei ſol regem Verkehr reiten die Verbindungswege der einzelnen Landſtrie nit mehr aus und es mußten die Landesherren auf Erritung guter Straßen bedat ſein. So entſtanden aus der Lauſi na Böhmen die Handelſtraßen Meißen, Camenz, Bauen, Löbau, Zittau, Gabel, Niemes, Weißwaſſer, Prag, weiter Zittau, Zwiau, Leipa, Dauba, Prag und Görli, Friedland, Reienberg, zu denen im Anfang des 15. Jahrhundertes der neue Weg von Meißen über Rumburg, Waltersdorf, Kraau, Reienberg, Turnau, Gitſin na Prag ſi anreihte. Die Inſtandhaltung dieſer Straßen und der Geleitſu auf denſelben oblag dem Landesherrn, weler hiefür Zölle dur ſeine Beamte einheben ließ. Später wurden dieſe Zölle Beſiern von Burgen, ferner an Städte und au an Bürger verpatet oder verliehen. Zollſtätte exiſtirten zu Camenz, Löbau, Bauen, Görli, Lauban, Zittau, Gabel, Niemes, Weißwaſſer, Jungbunzlau, Brandeis, Burg Oybin, B.-Zwiau, Burg Slaup oder Bürgſtein, Burg Mühlſtein ꝛc.
Gab es anfängli feſtgeſete, wenn au hohe Zölle und Geleite
ſo ſteigerten nur zu bald die Burgherren dieſe Abgaben in willkürlie Höhe. Ja die vorüberziehenden Handelsleute und Wanderer wurden na Räuberart geplündert und ihnen an ihrer Habe großer Saden verurſat. Erſt na längerer Zeit vereinigten ſi die Städte zur Vernitung der Raubburgen. Aus dieſem Grunde wurde au am Faſtnatsdienſtag 1337 die Burg Tollenſtein geſtürmt, geplündert und in Brand geſtet. Da ſi hiebei die Zittauer beſonders hervorthaten, erhielten dieſelben von ihrem Landesherrn Herzog Heinri von Jauer und Fürſtenberg in ihr Stadtwappen einen ſwarzen Adler im gelben Silde. Im Jahre 1339 den 15. October zerſtörten die vereinigten Städte die Burg Sönbu und unternahmen no mehr dergleien Heerzüge. Kaiſer Karl IV. erließ bei ſeinem Regierungsantritt ſtrenge Befehle gegen die Landesbeſädiger und begünſtigte vielfa den Handel na Böhmen. Zum Sue der Zittau-Prager Straße erbaute er 1357 die Burg Karlsfriede oder Neuhaus dur Ulri Cziſter und zum Sue des Zittau-Leipaer Weges legte er eine Beſaung in die Burg Molſtein. Wanek von Wartenberg ſoll wiederum die Veſte Tollenſtein neu und feſter erbaut haben. Seit Mitte des 14. Jahrhundertes hatten die Wartenberger die Burg Tollenſtein ſammt den zugehörigenOrtſaften inne. Wanco von Wartenberg, Obermundſenk von Böhmen präſentirte 1361 und 1367 Geiſtlie zur Pfarrei in Sönlinde, Wartenberg, Oſi, Swabi, Brenn, Vogtsdorf. Seine Söhne Johann Burggraf von Prag, Wenzel, Peter, Wilhelm und andere
folgten ihm 1369, beſeten 1370 mit Wilhelm Haſe von Haſenberg die Pfarrei zu Sönlinde und 1390 ſole zu Warnsdorf. Der älteſte Bruder wird 1397 Johannes de Rumburg alias de Wartenberg
der näſtälteſte 1396 Wenceslaus de Wartenberg dominus in Tolstein
genannt.
Die Wartenberger ſind bis 1398 urkundli als Beſier niederländiſer Torritorien angeführt. Gleizeitig findet ſi au als Theilbeſier der Sluenau-Tollenſteiner Herrſaft die auf Hohenſtein geſeſſene Linie der Berka von der Dauba vor.

Herren aus dieſem Geſlete haben bedeutenden Einfluß auf die Geſie des Landes genommen und hatten allezeit die angeſehendſten, witigſten geiſtlien wie weltlien Stellen inne. Später nahmen dieſelben von dem im Bunzlauer Kreis gelegenen Sloſſe Dauba den Namen Dauba an und breiteten ſi in viele Nebenlinien aus. Zwei gekreuzte ſwarze Eienäſte mit je 6 Zaen in gelbem Felde, auf deſſen Helm ein ausgebreiteter Flügel mit eben den Aeſten befindli war, bildete ihr Wappen.
Der Ahnherr der Hohenſtein'ſen Linie iſt jener Hinko (Hynek) Berka von der Dauba, weler zuerſt 1316 (¹²/₄) im Kampfe mit König Johann bekannt wird und ſpäter, 1321 bis zu ſeinem Tode 1348 Oberſt-Burggraf von Prag war; er iſt au der Gründer von Wießwaſſer ano 1337, (²⁴/₄). Genannter hinterließ zwei Söhne, Namens Hinko I., weler vom Kaiſer Karl IV. die ſäſiſe Herrſaft Hohenſtein am 16. August 1353 zu Lehen nahm und Heinri auf Hauska. Seine Wittwe Agnes hatte lebenslänglien Nugenuß von gewiſſen Theilen der hinterlaſſenen Güter, wel' letere na ihrem Tode an den Sohn Heinri fielen. Zu dieſen Gütern gehörten die Herrſaften Hohenſtein, Wildenſtein und Sluenau-Tollenstein. Erſte beide Domänen zählten ehedem ganz, letere zu Theil (Sluenau) zum Gaue Milsca, alſo zum Markgrafenthum Meißen.
bis zum Quell der Spree gereit habe. Neuere Forſungen Dr. H. Knothe's ergeben aber, daſs die Oberlauſi Milsca hieß und daſs obgenannte Orte urſprüngli zur Oberlauſi, nit zu Niſani gehörten, deſſen Grenze bei Sandau ſi befand. Die eigenartigen Kirenverhältniſſe des Niederlandes beſtätigen dieſe Anſit ganz vorzügli. Denn alle Kiren von Hainspa bis Georgswalde waren an Oberlauſier Mutterkiren vertheilt. Dagegen Rumburg, Sönlinde, Grund und Warnsdorf müſſen zum Gaue Zagoſt gehört haben. Endli Kreibi gehörte mit Kamni, Windiſ-Kamni und Roſendorf zur Leipaer Kire. Daraus erkennt man, daſs das jeige böhmiſe Niederland urſprüngli dreierlei Landeshoheit unterſtand, nämli Oberlauſi, Zagoſt und Böhmen.
Im Jahre 1359 den 1. April erhielt Johannes zu Holaun auf Präſentation des edlen Herren Henricus dictus Berca de Dauba die Pfarre in Slaknaw d. i. Sluenau. Wir ſehen alſo 1359 Sluenau als eine immerhin anſehnlie Kirengemeinde mit einer eigenen mehr oder minder gut fundirten Kire. Do iſt dieſer Ort bereits in der Meißner Bisthumsmatrikel vom Jahre 1346 als eigene Pfarrgemeinde angeführt. Wohl iſt uns dieſe Matrikel nur in einer Ueberarbeitung vom Ende des 15. Jahrhundertes, 1495, bekannt, allein aus ihr iſt genau zu erſehen, daß derſelben eine Faſſung von 1346 zu Grunde liegt. Die kirlien Grenzen blieben, trodem ſi die politiſen öfters änderten, wie früher fortbeſtehen und ſo kam es, daß die Hierarie ſelbſt über politiſ fremde Territorien ihre kirlie Mat ausübte, wie z. B. der Meißner Biſof über die Oberlauſi, als ſole zu Böhmen kam. Na obigen Bisthumsartikeln finden wir Sluenau bei der Sedes Hoenſtein und Sabeni als dritten Kirort verzeinet und hatte 3 Mark à 4 gr. böhm: Biſofszins an das Bisthum Meißen jährli zu entriten.
Zur Sedes Hoenſtein et Sabeni waren zugetheilt:
| Hoenſtein | mit zu zahlenden 4 Mark. | |
| Sebeni | (Sebni) | mit zu zahlenden 6 Mark. |
| Sloenaw | (Sluenau) | mit zu zahlenden 3 Mark. |
| Litenaw | alias et vere Lytenhan | mit zu zahlenden 2 Mark. |
| Nielsdorf | (Nixdorf) | mit zu zahlenden 1 Mark. |
| Nawſtath | (Neuſtadt) | mit zu zahlenden 5 Mark. |
| Lobedaw | (Lobendau) | mit zu zahlenden 2 Mark. |
| Sonow | (Sönau) | mit zu zahlenden 2 Mark. |
| Obersdorf | (Ulbersdorf) | mit zu zahlenden 1 Mark. |
| Sando | (Sandau) | mit zu zahlenden 2 Mark. |
| Altari in Nawſtat | (Neuſtadt): St. Barbara | mit zu zahlenden 1½ Mark. |
| Beate virgines Marie ibidem | mit zu zahlenden 2½ Mark. | |
| In Sluenaw altaria Altariste tres catates horas beate virginis ibidem, quilibet solvit unam marcam com media | mit zu zahlenden 4½ Mark. | |
| 36½ Mark. | ||
Unter das Decanat Budißin (Bauen) gehörte Steinit Wolframsdorf und Haynsba simul Zeidler, wele jährli 2½ Mark entriteten. Georgswalde war als Jergiswalde in die Sedes Loebau (Löbau) eingereiht und gab 1 Mark. Au die Dörfer Keyſerwalde, Roſenhein, Königiswalde, Rorſdorf (Groß-Röhrsdorf) ſind in der Sedes Biſofswerda genannt, obwohl dieſelben keine Kiren hatten.
Anno 1361 den 27. Jänner iſt die Filiale Sönlinde von der Rumburger Kire excindirt und dur Präſentation des Patrons Wanko [Werner] de Wartenberg mit dem vom Erzbiſof von Prag beſtätigten erſten Pfarrer Nikolaus beſet worden [Ex libro I. M5 Confirmationem piscopaly Pragensis in Biblioth. metropolitanae.]
Um dieſelbe Zeit, entweder kurz vorher oder kurz naher, iſt au die Rumburger Filiale Heinrisdorf in Seiffen ſelbſtſtändige Pfarrei geworden.
Na der Auswanderung der Proteſtanten kam Georgenthal zur Rumburger Kire und erhielt erſt 1656 wieder einen eigenen katholiſen Pfarrer. Au Warnsdorf gehörte ſeit 1650 zur Rumburger Kire und wurde im Jahre 1715 neuerdings ſelbſtſtändig.
Alt-Ehrenberg trennte ſi entgiltig 1736 von der Rumburger Mutterkire, Sönborn bekam 1873 eine eigene Kire und wurde der Rumburger Pfarrantheil dieſerhalb am 10. Dezember 1873 excondirt.
Weshalb die ſo nahe bei einander gelegenen Ortſaften verſiedene Erzprieſterſtühlen zugewieſen waren, iſt unbekannt. Wahrſeinli haben urſprünglie Beſtimmungen im Laufe der Zeit mane Veränderungen aus nit zu ermittelnden Urſaen erfahren. Wann die erſte Kire in Sluenau erbaut wurde, iſt au unergründbar. Weder Urkunden no die Tradition geben den geringſten Anhalt hiefür. Jedenfalls war ſole von nur beſeidenen Dimenſionen in höſt einfaer, ja primitiver Konſtruction.
Hinco I. von der Dauba auf Hohenſtein ſtarb um 1361 und ſein Bruder Heinri Berka von der Dauba übernahm die Vormundſaft über die von erſterem hinterlaſſenen Kinder. Für ſeine Mündel verpflitete ſi Leterer am 2. September, Donnerstag vor Johannis Enthauptung, daß dieſelben auf immerwährende Zeiten die Veſte Hohenſtein von dem Könige und der Krone Böhmens zu Lehen haben ſollten. Ebenſo vereinbarte Heinri mit Kaiſer Karl IV., daß, wenn alle ſeine Mündel kinderlos ſtürben, ihre ſämmtlien Güter und Lehen an die Krone zurüfallen; ſtürben aber die Söhne ohne leiblie Erben, ſo gelange nur Hohenſtein nebſt den übrigen Lehengütern an die Krone, während das Eigengut, zu dem au die Herrſaft Leipa gehörte, an die überlebenden Sweſtern überwieſen würde.
Na dem Ableben des Hinko I. auf Hohenſtein bekam ſein älterer Sohn Hinko II. die Herrſaften Hohenſtein nebſt Sluenau, ſowie gewiſſe Dörfer bei Leipa, ſein jüngerer Sohn, ebenfalls Hinko genannt, das Eigengut Leipa. Hinko II. bekam Rumburg no unter ſeinem Vormund Heinri, die Herrſaft Tollenſtein, wele 1398 no den Herren von Wartenberg gehörte, bald na dieſem Jahre. Anno 1388 iſt Hinko II. Statthalter in den damals dem böhmiſen Könige Wenzel gehörenden Beſiungen Mühlberg nebſt Strehla an der Elbe und 1396 ſogar Oberſtlandriter Böhmens. Tro dieſen erhaltenen Ehrenſtellen blieb Hinko II. kein Freund des Königs. Als Herzog Johann von Görli, ein Bruder König Wenzels 1396 ſtarb und ſi deſſen Vetter Markgraf Joſt von Mähren in den Beſi der Niederlauſi ſete, übernahm Hinco II. die ihm angetragene Stelle eines Landvogtes der Niederlauſi, weles Amt derſelbe bis 1407 inne hatte.
Der Landvogt von Görli Anshelm von Ronaw, ein Anhänger des Markgrafen Joſt verkaufte auf deſſen Anrathen und aus Furt vor König Wenzel ſeine Herrſaft Ronaw bei Zittau an Hinco II. von Hohenſtein und Hinco Hlawatſ von der Daube auf Leipa, ein Brudersſohn Hincos des II. Wie aus der Aufforderung König Wenzels an die Sesſtädte Budißin, Görli, Zittau, Lauban, Löbau und Camen ddto. Bettler am St. Martinstage (¹¹/₁₁) 1396, zur Zerſtörung der Burg Ronaw zu erſehen iſt, nannte König Wenzel ſowohl den Markgrafen Joſt wie die Berka ſeine Feinde und es kann nit verwundern, daß demzufolge dieMannen der Berka's auf Ronaw ſi nunmehr feindli gegen die Sesſtädte verhielten; ganz beſonders mußte Zittau allerhand Beläſtigungen und Wegelagerei erdulden.
Hinco II. forderte als Landvogt der Niederlauſivon dem königli geſinnten Ritter von Hoenborn auf Priebus, daßer dem Markgrafen als neuem Landesherrn huldige. Da ſi ſelbiger aber weigerte dieß zu thun, belagerte Hinco Berka des erſteren Burg und brannte ſein Städtlein nieder. Ritter von Hoenborn rief nun die Sesſtädte zur ſleunigen Hilfe, wele dieſelben na manerlei Berathungen und Tage zu Löbau da man ſi mit ihm verbrieft hatte
gewährte. Au König Wenzel nahm nomals Veranlaſſung mit Brief ddto Prag am Montag na St. Thomas (²³/₁₂) 1398 die Sesſtädte zur Zerſtörung der Burg Ronaw aufzufordern und im Januar 1399 erfolgte die Belagerung und Eroberung dieſer Veſte.
Hinco II. verſöhnte ſi bald hierauf wieder mit König Wenzel und wurde 1405 Landfriedenshüter im Kreiſe Leitmeri. Von nun an kehrte Erſterer aus der Niederlauſi zu längerem Aufenthalte na Hohenſtein, wo er ſi bisher nur wenig aufgehalten hatte. Er vermehrte ſeinen Herrſaftsbeſi dur Ankauf neuer Güter. Au jene in der Sluenau-Tollenſtein'ſen Herrſaft, wele no die Wartenberger beſaßen wurden ſein Eigenthum und ſo ſehen wir ihn 1370 als Patron zu Rumburg, 1404 zu Warnsdorf, 1404 zu Sönlinde; weiteres belehnte derſelbe am 11. Auguſt 1405 die Gebrüder Benedict nebſt Wenzel von Yba (Eybau) mit dem Gerite zu Seifhennersdorf. Seinem Lehensmann Willri von Dobriſ zu Sönau genehmigte er den am 27. Juli 1404 von dieſem ausgefertigten Verkauf von 8 ungariſen Gulden Zins auf eine Menge namentli aufgeführter Bauern für 80 fl. an den Prieſter Miael Drebni und deſſen Bruder, dem Bürger Hannos. Ebenſo beſaß Hinco II. 1406. im Erbwege anheim gefallen, Kamni und Kreibi. Die bisher dem Johann von Mielsberg eigenthümli gehörenden Güter Sarfenſtein, ſowie Benſen galngten anno 1409 an Hinco II. auf Hohenſtein, der nun in Böhmen allein mehr als 10 □ Meilen Grundbeſi in Eigenthum hatte.
Am 29. Juli 1388 kam auf Befürwortung Hinco II. Miael von Slaknovia (Sluenau) als Pfarrer na Boganavilla. Zu Beginn des 15. Jahrhundertes wurde von ihm Henrico Birk von der Dauben domino in Hohenſtein
die Frühmeſſe von Lobendau in Sebni geſtiftet, wofür die Zinſe 15 gl. 6 Pf. 1 Mark betrugen und ſind hiebei Hans von Lutti Hauptmann und Damm (Tamme) Knoblau als Zeugen erwähnt.
Bei der energiſen Wahrung ſeiner Gebietsgrenzen konnte es nit ausbleiben, daß Hinco II.mit den Markgrafen von Meißen in Händel gerieth. Anlaß boten hauptsäli die meißniſen Vaſallen von Rathen und Wehlen, deren Ländereien ringsum von Hohenſteiner Gebiet umſloſſen war. Dieſelben ſuten und fanden Hilfe bei ihren Lehensherren, den Markgrafen von Meißen.
Nadem Vereinigungsberit von 1410 zwiſen dem edlen Herrn Heinri Herr auf dem Wildenstein und Herrn Hinko Herr auf Sarfenſtein zu ſließen, ſeint Hinco II. anno 1410 geſtorben zu ſein. In dieſer Urkunde wird Wildenstein als eigene Herrſaft erwähnt. Jedenfalls iſt dieſelbe erſt 1410 dur teſtamentariſe Beſtimmungen Hinco II. geſaffen worden.
Es erbten na deſſen Tode ſeine Söhne: Hinco III. der Jüngere auf Hohenſtein, Antheil Warnsdorf, Sönau, Nixdorf (Niilſtorff), Roſenhain, Sirgiswalde, Königswalde und Antheil Georgswalde (Gerigiswalde), Rumburg (Ronneberg), Seifhennersdorf böhmiſen Antheils, (Heynirſtorff), das Städten Sluenau die Hälfte, das Dorf Kaiſerswalde die Hälfte, die Dörfer Zeidler, Nixdorf, Wölmsdorf (Willemesdorff), der Spremberger Wald oberhalb Sluenau, der Nixdorfer oberhalb Sebni die Hälfte, der Persk die Hälfte und der Poczin oberhalb Sluenau ganz.
Johann auf Tollenſtein bekam Sloſs Tollenſtein, Antheil von Warnsdorf und Seifhennersdorf, Kreibi, Kamni, Sandau mit dazu gehörigen Dörfern, Fridewald, Falkenſtein, Chlum. Derſelbe ſtarb kinderlos bald nach 1424 und vermate den größten Theil dieſer Güter ſeinem Bruder Heinri auf Wildenſtein, während Burg Tollenſtein und einige Dörfer Hinco III. d. J. erhielt.
Heinri auf Wildenſtein erbte das Rittergut Polenz, die Hälfte der Stadt Neuſtadt bei Stolpen, die zu Lehen ausgegebenen Güter Langburkersdorf, Krummhennersdorf, Rugiswalde, Rathmannsdorf, die Stadt Sebni und die Dörfer Hertigswalde, Heunersdorf, Litenhain, Mitteldorf, Gosdorf, Hinterhermsdorf, Saupsdorf, Hinterottendorf, endli ſüdli der Kirnitſ Oſtrau wie Poſtelwi ſammt dem Waldgebirge bis zu der jeigen Grenze gegen Böhmen und der Burg Wildenſtein.
Hinco der Aeltere hatte Sarfenſtein. No vor dem Jahre 1437 muß er geſtorben ſein, nadem er vor 1433 ſein Gut Sulden halber an Henik von Skal (au von Waldſtein) abgetreten hatte.
Dem 5. Bruder Beneſ wurde zugewieſen: Die Burg Rathen ſammt Zugehör nebſt dem übrigen Theile der Sluenau-Rumburger Herrſaft. Rathen konnte aber Beneſ nit lange behauptet haben, da 1428 dieſen Beſi Friedri von der Oelsni hatte. Kurz na dem Tode Johann's auf Tollenſtein muß Bruder Heinri den Wildenſteiner Beſi an Beneſ — um 1426 etwa — abgetreten haben. Die Söhne des Leteren, Beneſ, Hinco und Albret werden ſeit 1436 als Herren auf Wildenſtein genannt. Burg Tollenſtein ſammt Zugehör erwarb Sohn Albret von ſeinem Onkel Hinco III. d. J. und war 1444 ſon hievon Beſier.
Dur das väterlie Erbe, dur Erhalt von Tollenſtein ſammt Dörfern 1444 und dur den Gütertauſ mit dem ſäſiſen Churfürſten 1451 wurde Albret der Alleinbeſier der Herrſaften Sluenau, Rumburg, Tollenſtein.
Dieſe Brüder hatten no eine Sweſter, Namens Anna, Witwe des Nicolaus Kolowrat. Derſelben überließ Hinco wiederkäufli das Dorf Saupsdorf, weles 1447 der Kurfürſt Friedri der Sanftmüthige einlöſte.
Unter Hinco III. beſtieg Rudolf von Plani (1411 — 1427) den Meißner Biſofsſtuhl, der jedo mit großen Geldcalamitäten zu kämpfen hatte. Urſaen hievon waren die zurügelaſſenen bedeutenden Sulden ſeines Vorgängers Biſof Thimo (1399 – 1410); die auf 2800 Goldgulden ſi belaufenden Koſten der päpſtlien Beſtätigung, die am 1. Juli 1411 dur ein furtbares Hagelwetter ſtattgehabte Verwüſtung der biſöflien Felder bei Mügeln und der am 29. Auguſt ſelbigen Jahres erfolgte Brand der Stadt Biſofswerda. Biſof Rudolf mußte nit allein zum Verkaufe von Grundſtüen ſreiten, ſondern au Darlehen aufnehmen.
Au Hinco III. lieh ihm 60 Mark Groſen, wele 1414, Dienſtag na Katharina, Biſof Rudolf in beſtimmter Friſt zurüzuzahlen verſpra oder ſonſt gezwungen war, einzureiten in die Stadt Sluenau. In dieſer Urkunde wird Sluenau als Stadt erwähnt. Da dieſer Ort ſon 1359 dem Hinco Berka auf Hohenſtein gehörte, dürften die Berka auf Hohenſtein wohl die Erhebung zur Stadt dur königlie Verleihung des Stadtretes erwirkt haben. Urkunden darüber gibt es leider nit; wenigſtens finden ſi au in Erben's und Emler's böhmiſen Regeſten keine angeführt.
Die Verleihung des Marktretes war es, weles damals einen Ort zur Stadt erhob und die Grundlage für die Entwilung ſtädtiſer Verfaſſung wurde.
Das Marktret ging vom Könige aus; dieſer verlieh es ſpäter Grafen und au Biſöfen, zunäſt für ihre Sie und dadur erhielten dieſe das Recht zur Erhebung von Zoll- nebſt Marktgeldern.
Dur Herbeiziehung neuer Coloniſten um Sluenau gewann Hinco III. nit nur neuen Zehent, ſondern au die wirthſaftlien Verhältniſſe beſſerten ſi daſelbſt. Von der Viehzut überging man mehr zum Aerbau, neues Aerland wurde gerodet, bebaut und ſo mane Sumpfſtreen urbar gemat.
Sluenau hatte zu Zeiten Hinco Berka's bereits Bedeutung gewonnen und war befeſtigt; umgeben von Mauern mit 2 gemauerten Thoren, ebenſo mit Gräben umzogen, barg die Stadt in ſi au das Landſloſs.
Für die Entwilung der Stadt hat Hinco Berka bedeutend beigetragen. Au wurde Sluenau von den Berka'ſen Grundherren das Stadtwappen, zwei gekreuzte Eienäſte mit je 6 Zaen in gelbem Felde verliehen. Hinco III. wahrte und vertheidigte na jeder Ritung hin ſeine Beſirete und kam ſo mit ſeinen Nabarn in öfteren Streit. Wie früher ſein Vater, ſo kam au er bald mit der Oberlauſi in Conflict. Der Beſier des Rittergutes Tſoa im Queiskreiſe Heinri Renker von Löwenberg und Heinri von Redern fielen 1419 mit ihrem Kriegsvolk in Herrn Berken von Hohenſtein's
Land und plünderten das Dorf Jerigiswalde
(Sirgiswalde). Auf ihrem Rüzuge na Tſoa brannten und raubten ſie au in oberlauſiiſen Dörfern, weshalb der damalige Landvogt Hinco Hlawatſ Berka auf Leipa die Zittauer gegen die Unruheſtifter aufbot. Unweit Oſtri kam es zum Zuſammenſtoß, die Zittauer blieben Sieger und nahmen Renker wie Reder gefangen.
No weit bewegter geſtalteten ſi nit nur für Hinco III. ſondern für ganz Böhmen und der Lauſidie bald hierauf folgenden äußeren Ereigniſſe, der Ausbru des unheilvollen, blutigen Huſſittenkrieges.